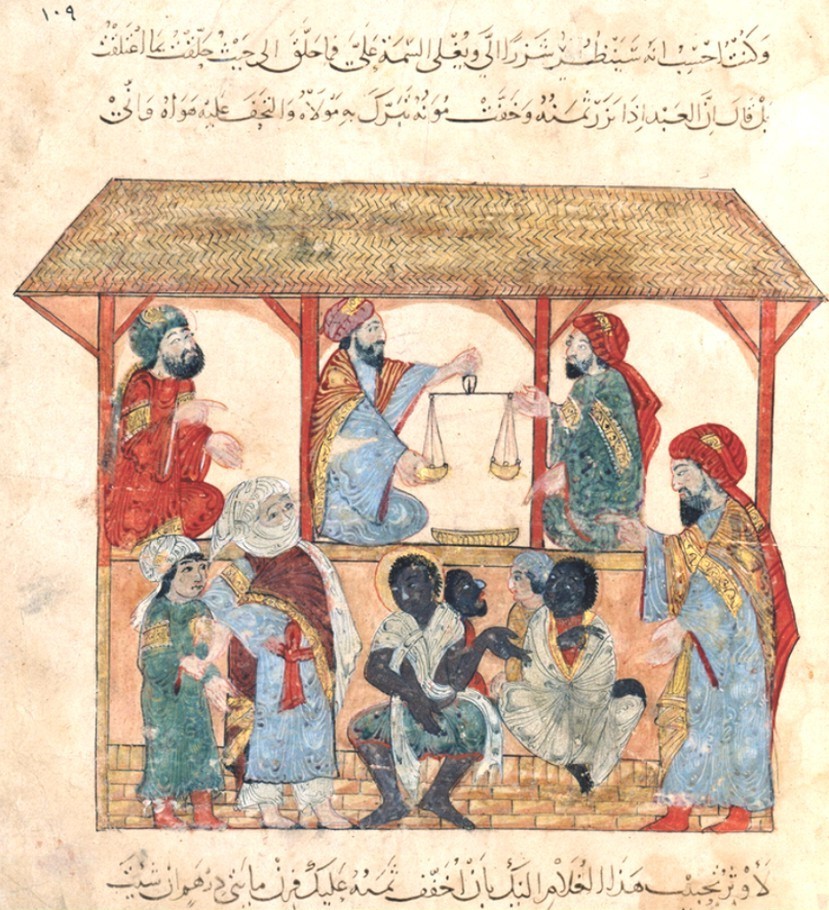Im Bestand der Beinecke Rare
Book and Manuscript Library der Universität Yale befindet sich seit
1969 ein geheimnisvolles Manuskript, das bis heute trotz zahlreicher Versuche
weder in seiner Bedeutung noch in seinem Inhalt entschlüsselt werden konnte –
vorausgesetzt, es gibt überhaupt einen sinnvollen Inhalt, der erschlossen
werden kann. Auch die genaue Herkunft und Entstehung des Manuskripts ist unklar
und konnte seit Jahrhunderten nicht in allen Details geklärt werden. Bis heute
hält das sogenannte Voynich-Manuskript mehr Fragen als Antworten bereit und
unser neuester Artikel verfolgt das Ziel, diese vorzustellen und die bisherige
wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Dokument im Hinblick auf seine
Geschichte, seine Inhalte und die Versuche seiner Entschlüsselung
nachzuvollziehen.
 |
Abbildung
aus der astronomischen Sektion (f. 68r)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/68r.jpg